Sommerbesucher in Irland sind regelmäßig überrschascht, wenn sie erfahren, was im irischen Winter so alles passiert. Beispiel: Die mächtigen Berg- und Ginsterfeuer, die jedes Jahr wiederkehren. Was es damit suf sich hat, habe ich im Februar 2010 auf Irlandnews beschrieben. Hier der Beitrag, der an Aktualität nichts verloren hat, noch einmal. Die Zeit der Feuer ist nämlich wieder angebrochen: Es ist kalt, es ist trocken und es weht der Ostwind.


Ein erschöpfter Feuerwehrmann erzählte uns im Jahr 2008, dass die Feuer in West Cork in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen hätten und dass dies vor allem mit der Lage der Landwirtschaft zu tun hat: Diese ist auf dem Rückzug, das Land wächst zu, und die Farmer betreiben ihre Landwirtschaft meist nur noch nebenbei. Deshalb ist es oft dass Leichteste, bei trockenem Ostwind einfach ein Streichholz ans dürre Gras zu halten. Andererseits hat das Abfackeln auch Tradition und ist deshalb schwer ausrottbar: Die Bauern glauben, dass das Land durch die Feuer fruchtbarer würde. Ein Irrglaube.
Diese Feuer sind ökologisch katastrophal, sie zerstören einseitig einen Großteil der Vegetation, töten Dachse, Käfer und andere Insekten, zerstören Vogelnester und Gelege, geraten oft außer Kontrolle und bedrohen auch schon mal Wohnhäuser, Schulen, Ställe. Die Feuer bereiten allerdings auch die Wiesen bestens als Schafweiden vor: Im Winter abgebrannte Wiesen stehen im Frühjahr als erste in sattem Grün.
Ein besonnener und naturnaher Bauer erklärte uns, dass es diese Feuer in der Vergangenheit tatsächlich nicht in dieser Menge und Größe gegeben habe. Der Grund: In den “alten Zeiten” (die vor vielleicht zehn Jahren zu Ende gingen) haben die Bauern ihr Vieh zweimal pro Jahr auf dieselbe Weide geschickt: Um die weniger schmackhaften Pflanzen wie Ginster und Gagel wegzubekommen, muss die Wiese auch im Winter beweidet werden, wenn das Nahrungsangebot eingeschränkt und das Vieh weniger wählerisch ist. Das allerdings passiert heute fast gar nicht mehr. Große Flächen liegen völlig brach, und so findet das Feuer reichlich Nahrung und kann sich rasend schnell und großflächig ausbreiten.

Die Feuer werden übrigens nur im Winter gelegt. Wenn die Urlauber ab Mai nach Irland kommen, sehen sie nur die herrlichen saftig-grünen Wiesen und fragen nicht lange nach, wie das vermeintliche Idyll zustande kam. Unsere Fotos entstanden in West Cork, Kerry und auf der Dingle Peninsula. Sie stammen aus den Jahren 2007 und 2008 und 2010. Und hier noch ein aktuelles Foto aus diesem Jahr. So sehen die Feuer nachts aus: Der gespenstisch erleuchtete Sheeps Head, der fast ausnahmlos jedes Jahr rigoros kahl gebrannt wird. Fotografiert Ende Februar 2013:
Fotos: Markus Bäuchle, Bodo Baginski (erstes und vorletztes Bild), Antje Wendel (letztes Bild)









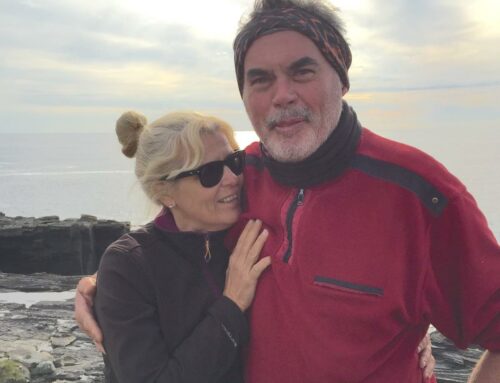

Wie kann man nur so ignorant mit seiner eigenen und anderer Leute Sicherheit umgehen ??? Nur weil man es schon seit Jahrhunderten so macht, ist es noch lange nicht gut.Da muss es doch auch was anderes geben ….
Gruß Tina
Ein bisschen spät, aber wegen der Brisanz noch als Ergänzung:
http://www.dinglenews.com meldete am 12.02., dass ein Feuer zum Abbrennen des Stechginsters derart nah an Dingle Town/Co. Kerry entzündet wurde, dass das dortige Krankenhaus sowie Siedlungen im Norden und Nordwesten der Stadt in Gefahr gerieten. Die Feuerwehr von Dingle sowie zwei Löschzüge aus dem 50 km entfernten Tralee waren bis in die Nacht fieberhaft damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, die kleine Stadt lag unter einer dicken Rauchdecke.
In Südkerry bei Cahersiveen haben die Ginsterfeuer schon einen Toten gefordert: der 80jährige Michael O'Shea erstickte beim Feuerlegen an den Rauchschwaden.
Die Feuerwehr bittet offiziell darum, dass aus Sicherheitsgründen vor dem Legen eines Feuers nicht nur sie, sondern auch Waldbesitzer und Nachbarn informiert werden. Ob das nun wohl geschehen wird??? So hanebüchen diese Aktionen auch sind, dass sie auch noch Menschenleben gefährden, darf nicht sein.
Seufz. So sind sie. Watt willste machen? – Grusligschöne Fotos…