 Das Leben am Rande Europas im entlegenen Südwesten Irlands hat einige Schattenseiten und viele Vorzüge. Reden wir von den Vorteilen: Egal, in welche Richtung wir fahren: Der nächste Shop ist knapp fünf Kilometer entfernt und in beiden Fällen eine Tankstelle mit kleinem Supermarkt und bescheidenem Basisangebot. Ähnlich attraktiv das Warenagebot im nächsten Dorf, in der nächsten Stadt. Die Gelegenheit zu Spontankäufen, zu Frust- und Belohnungs-Shopping hält sich deshalb in engen Grenzen. Die nächste Großstadt, die kauffreudige Westeuropäer unter echten Konsumdruck setzen würde, hält einen Sicherheitsabstand von 80 Minuten.
Das Leben am Rande Europas im entlegenen Südwesten Irlands hat einige Schattenseiten und viele Vorzüge. Reden wir von den Vorteilen: Egal, in welche Richtung wir fahren: Der nächste Shop ist knapp fünf Kilometer entfernt und in beiden Fällen eine Tankstelle mit kleinem Supermarkt und bescheidenem Basisangebot. Ähnlich attraktiv das Warenagebot im nächsten Dorf, in der nächsten Stadt. Die Gelegenheit zu Spontankäufen, zu Frust- und Belohnungs-Shopping hält sich deshalb in engen Grenzen. Die nächste Großstadt, die kauffreudige Westeuropäer unter echten Konsumdruck setzen würde, hält einen Sicherheitsabstand von 80 Minuten.
Bleibt das Internet, das alle Waren dieser Welt auf Knopfdruck bereit hält, solange die Kreditkarte mitspielt. Es mag eine Altersangelegenheit sein, doch die Distanz, die das Online-Medium zur sinnlich erfahrbaren Ware schafft – vergrößert noch durch hochgradig unzuverlässige Kurierdienste – erstickt die meisten Kauf-mich-Impulse im Keim (Ausnahme: Musik. Wir haben kräftig mitgeholfen, Apple iTunes groß zu machen).
Und dennoch: Ein unvoreingenommener distanzierter Blick in die Wohnung erschreckt: Mit wie vielen materiellen Dingen umgeben wir uns, verstellen wir uns den Blick, nehmen wir uns Raum? Wie viele persönliche Habseligkeiten besitzen wir jeweils, wie viele besitzen wir gemeinschaftlich als Familie? Viele. Zu viele. Viel zu viele. Wie viele davon benutzen wir, wie viele benötigen wir? Vielleicht sollten wir uns tatsächlich wieder einmal einem Selbstversuch unterziehen und unsere Bestände durchforsten, um in einem zweiten Schritt Ballast abzuwerfen.
Was dem Wanderer schon lange durch den Kopf geht und was er alle paar Jahre immer mal wieder eher locker betrieben hat, das ging nun ein 37-jähriger Kalifornier ganz systematisch an: Der Computerarbeiter Dave Bruno, der sich seit ein paar Jahren der Konsumkritik verschrieben hat, startete im vergangenen November die “100 Things Challenge”. Er nahm sich vor, ein Jahr lang mit weniger als 100 persönlichen Gegenständen auszukommen und fing an, seinen Bestand von über 400 Habseligkeiten auszusortieren und zu verschenken oder zu verkaufen. Mittlerweile besitzt Dave bereits
deutlich unter 100 Dinge – wobei das Gemeinschaftseigentum der Familie und seine Leidenschaft “Bücher” ausgenommen sind. Socken und Unterhosen zählen jeweils nur einmal, als Sammelkategorie.
Dave Bruno will mit seiner Aktion ein Zeichen setzen gegen Konsumismus und Konsumterror – und dies könnte ihm über den eigenen Tellerrand hinaus gelingen. Über das materielle
Abspeck-Projekt und seinen Blog berichten mittlerweile zahlreiche Medien, was Dave Bruno nun einen Buchvertrag eingebracht hat. Das Projekt soll 2010 in Papierform herauskommen, damit andere es kaufen (!) können. Die Idee ist natürlich keineswegs neu. Die Simplicity-Bewegung in Nordamerika hat zahlreiche Sympathisanten, der Engländer Tom Hodgkinson schrieb schon vor Jahren in “How to be Idle” und “How to be Free” vergnügt über den Konsumverzicht in Zeiten des Konsumwahns, und auch die Küstenmachers haben mit “Simplify your Life” diese Welle erfolgreich geritten . Eigentlich fing das Gier-und-Haben-Wollen-Problem schon bei Adam und Eva an – und frühe christliche Denker wie Thomas von Aquin haben bereits Lösungen angeboten.In einer Welt, wo Konsumieren oberste Bürgerpflicht ist, wo die Politik nicht in der Lage ist, Alternativen zum wachstumsorientierten Wirtschaften aufzuspüren, wo andererseits die Resourcen ausgehen und auf Kosten unserer Kinder überbeansprucht werden – in dieser Welt kann sich jeder/jede Einzelne einmal in der eigenen Wohnung umschauen und anfangen die Gegenstände zu zählen. Ist man/frau erst einmal in der Übung, werden deutlich weniger überflüssige Dinge angeschafft und Gebrauchsgegenstände mit eher guter, langlebiger Qualität (ChiNO) nachgekauft.
Übrigens: Ein buddhistischer Mönch muss mit acht Gegenständen auskommen: der Almosenschale, dem Rasiermesser, einer Nadel, einem Zahnholz, einem Sieb, einem Stock, einem Gürtel und drei Tüchern als Kleidung. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die acht Autos besitzen, oder Sammler, die 1.000 Buddhas, 5.000 Igel oder 10.000 Musik-CDs ihr eigen nennen.
PS: Was ist mit Kunst, die sich allen Nützlichkeitserwägungen per se entzieht?
Das Leben am Rande Europas im entlegenen Südwesten Irlands hat einige Schattenseiten und viele Vorzüge. Reden wir von den Vorteilen: Egal, in welche Richtung wir fahren: Der nächste Shop ist knapp fünf Kilometer entfernt und in beiden Fällen eine Tankstelle mit kleinem Supermarkt und bescheidenem Basisangebot. Ähnlich attraktiv das Warenagebot im nächsten Dorf, in der nächsten Stadt. Die Gelegenheit zu Spontankäufen, zu Frust- und Belohnungs-Shopping hält sich deshalb in engen Grenzen. Die nächste Großstadt, die kauffreudige Westeuropäer unter echten Konsumdruck setzen würde, hält einen Sicherheitsabstand von 80 Minuten.





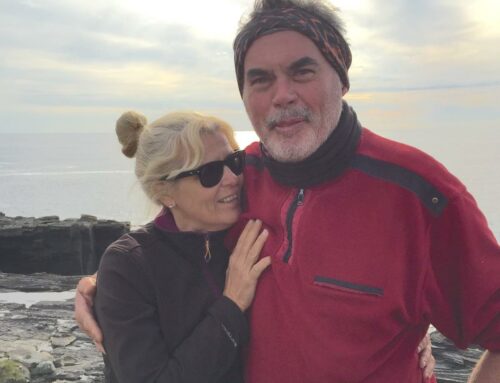

schon richtig – trotzdem ist eine 100 things challenge mit einer exclusion list, die mindestens nochmal 100 Eintraege hat, fuer mich nicht glaubwuerdig.
Meine Methode ist an sich gar keine – und schon mal gar nicht aus Prinzip, das hat sich halt so ergeben. Mein Vater war bei der Bundeswehr, da haben wir eine Menge Standortwechsel mitgemacht. Und nachdem ich zuhause ausgezogen bin, hat sich der 2 Jahres Rhythmus erst mit Uni und dann mit Jobs so eingependelt. Keine grosse Sache also.
Hilft aber bei der Besitzbeschraenkung – im Moment haben wir nicht mal eigene Moebel, da man Wohnungen hier ja meistens moebliert bekommt.
@Bjorn. Sich zu beschränken ist natürlich eine sehr relative Angelegenheit. Hast Du viel angehäuft, musst Du Dich von umso mehr trennen. Deine Methode erscheint mir interessant. Ziehst Du aus Prinzip um, oder hat das andere Gründe (Beruf etc,)?
was fuer eine bekloppte Idee – ich koennte das ja ernst nehmen, wenn der gute Mann wirklich nur 100 Dinge behalten haette (und jede Socke und jeder Q-Tip zaehlt einzeln!!). Was er da macht, ist kaum mehr als ein grosser Haufen wohlformuliertes Blabla. Nur weil man einmal die Woche kein Fleisch auf dem Teller hat, ist man noch lange kein Vegetarier.
Erfolgreiche Selbstvermarktung immerhin – er verzichtet auf das zweite Paar Wanderschuhe, lamentiert ueber eine kaputte Uhr, nennt das ganze 100 Things Challenge und kriegt einen Buchvertrag. Bravo. Warum faellt mir sowas nicht ein ??
Und nebenbei – es gibt eine sehr einfache Loesung, um sich nicht zu viel Zeug ans Bein zu binden – das funktioniert fuer mich seit 40 Jahren recht gut. Ich ziehe im Durchschnitt alle zwei Jahre um. Nicht notwendigerweise in eine neue Stadt oder gar ein anderes Land, aber immerhin in eine neue Wohnung. Und dabei kann man gut rausfinden, welche Sachen man braucht und benutzt und welche nicht. Wenn etwas in zwei Jahren nicht angefasst worden ist, kann man es weggeben.
Very simple – job done. Und man kann sich diese ganze Wohlstandsromantik schenken und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Neue Sachen kaufen ;-)
Danke, Nicola, das ist missverständlich formuliert: In dem Satz steckt die Aufforderung, zwischen Gebrauchs-und Kunst-Gegenständen zu unterscheiden, also Kunst nicht miteinzubeziehen. Kunst ist in der Intention zweck-frei, nicht nutzen-orientiert, bezweckt nicht, nützlich, verwertbar, benutzbar zu sein – entzieht sich der praktischen Nutzung durch Überhöhung. Ist dies nicht oder nur zum Teil der Fall, würde ich von Kunsthandwerk sprechen. Aber: In der Wirkung kann Kunst dem Menschen natürlich sehr "nützen", in dem Sinne, wie Du es beschreibst.
Warum ist Kunst nicht nützlich??? Kunst (zumindest das, was ich darunter verstehe) ist Schönheit, und Schönheit heilt die Seele. Das haben die meisten von uns nötig. Kunst ist für manche auch eine Quelle der Kraft – sei es bei der "Herstellung", sei es beim "Genuss", und somit äußerst nützlich!