Irlandnews-Autorin Sandra Böttcher stellt heute ein ganz besonderes irisches Buch vor: ‘Grabgeflüster’ von Máirtín Ó Cadhain, ins Deutsche übersetzt von Gabriele Haefs.
Stellen Sie sich vor, Sie sind tot, und das ganze Elend geht einfach weiter. In Máirtín Ó Cadhains Grabgeflüster sind sämtliche Protagonisten tot und begraben, doch unter der Erde treffen sie sich wieder – und jammern, lästern, schimpfen, fluchen und intrigieren, dass es eine wahre Lust ist. Die Hölle? Vielleicht. Vor allem aber ein sprachliches Feuerwerk, dessen Autor nicht zu Unrecht als der irischsprachige Joyce gilt. Das Buch der Bücher im gälischsprachigen Irland, ein Mythos im übrigen Land, erstmals ins Deutsche übersetzt von Gabriele Haefs*.
Der Schauplatz ist ein Dorffriedhof in einer Gegend westlich von Galway, wo Máirtín Ó Cadhain (gesprochen Martin O Kein) selbst aufgewachsen ist (in Cois Fharraige, Connemara Gaeltacht). In seinem Roman nennt Ó Cadhain die Stadt Galway, welche auch Gesprächsthema und Schauplatz ist, “die Helle Stadt”.
Die Bürger des Dorfes sind einfache Leute, ein Priester, Arbeiter, Bauern, ein Schulmeister. Alle Personen sind tot und zu Grabe getragen. Es sind ihre Stimmen, die sich unsichtbar, aber lauthals bemerkbar machen. Kaum sind sie unter der Erde, fangen sie an aufzuwiegeln und zu intrigieren, genau so, wie sie es zu ihren Lebzeiten getan haben.
Es ist schwierig bis unmöglich, die Handlung zusammenzufassen – denn es gibt eigentlich keine. Ich benötige einige Anläufe, um mich auf die unaufhaltsam keifenden Toten einzulassen. Etliche Protagonisten sind am Anfang des Buches in einer Übersicht beschrieben, auf die ich immer wieder zurückgreife und es hilft, in die beginnenden, andauernden und ausgelassenen Reden einzusteigen. Die sprechenden Personen werden nicht visuell konturiert, sie sind vielmehr an den bestimmten Floskeln zu erkennen, die am Anfang ihrer Reden ausgerufen werden: „Meine Herren die Lerche”!, „Meiner Seel“!, „Ich bin verstopft“! “Bloody tear and ‚ounds“…, „Beim tiefen Ozean“!
Die Kunst des Beleidigens: Ein schlechtes Wort für Jeden . . .
Kern des Buches ist also nicht etwa der Plot, sondern die Sprache und Witz und im Wesentlichen das unaufhaltsame Fluchen, Beschimpfen und Beleidigen: „…Möge sein Arsch sich verknoten! Mögen Klauenseuche, Schafslähmung, Dasselfliegen, Spulwürmer, Mehltau und Fallsucht ihn verzehren… Mögen die Altersleiden der Vettel von Beara ihn verzehren [Anm.: die alte Frau von Beara, sagenhaftes Symbol für Irland]…“!
Es gibt eine „Hauptdarstellerin“, die zu Anfang frisch beerdigte Caitríona. Sie führt bis zum Ende das Wort und dient mir als Orientierung in der Totengemeinschaft. Caitríona ist engstirnig, kleinlich, manchmal cholerisch. Die größte Quasselstrippe im Ensemble der sterblichen Hüllen findet ein schlechtes Wort für Jeden. Eine besondere Abneigung hat Caitríona gegen ihre jüngere Schwester Neil und ihre Schwiegertochter. Auf Letztere wettert Caitríona:„Gewiss doch wird die ständig Kränkelnde die nächste Schwangerschaft nicht überleben? Der arme Pádraig wäre ohne sie besser dran“. Die „unten“ enttäuschte Caitríona wird nicht müde, ihren Refrain „Ich platze gleich! Ich platze gleich!“ rauszuposaunen. Sie hofft auf ihren einzigen Sohn Pádraig: Ich möchte ja wissen, wann sie mir endlich das Kreuz aufstellen… ein Kreuz aus Kalkstein von den Inseln“! [Anm.: Aran Islands]… „Hier ein Kreuz zu haben, ist wie ein großes Schieferhaus über der Erde“.
Wie im Leben vor dem Tode dreht sich oben wie unten vieles um Geld, Neid, Intrigen und es wird Glaube und Aberglaube mit Realität und Faktischem vermengt. Weil das Leben auch immer neue Tote produziert, wird es unter Tage nicht langweilig. Die frisch Beerdigten bringen Klatsch, Tratsch und reichlich Stoff zum Streiten mit, streben nach Statussymbolen: Wer hat wen betrogen, wer hatte das meiste Ansehen im Leben, wer das schönere Haus. Die modernden Mäuler debattieren über geklauten Torf, gepanschten Whiskey, schiefe Schornsteine, tote Fohlen und verstauchte Knöchel.
Nóra, Mutter der kränkelnden Schwiegertochter Caitríonas, sieht sich als „Kulturbeauftragte des Friedhofs“. Sie stellt sich für die „Fünfzehn-Schilling-Partei zur Wahl. Dagegen stehen die Nominierten der Pfundleichen und Halbe-Guinee-Leichen. Diese halten gern einmal herausfordernde Reden: „Aber wir, liebe Mitleichen, sind die Partei der Arbeiterklasse, des Proletariats, der Kleinbauern, die Partei der Unfreien und der Pächter und der Strohdächer, die Partei der Enteigneten“.
Groß ist auch das Entsetzen, als herauskommt, dass die lieben Nachkommen das Erbe vertrinken, oder in die Ausbildung ihrer Kinder stecken oder auf ähnliche Weise aus dem Fenster werfen. Der Schulmeister, über viele Kapitel hinweg der unangefochtene Intellektuelle des Friedhofs, ist in der Vorstellung gestorben, dass seine Witwe ihn zutiefst betrauern wird, und findet in seinem Grab bei diesem Gedanken Trost… bis er erfährt, dass sie ihn schon mit dem Postboten betrogen hat, als er noch aufgebahrt in der Küche lag!
Das Buch spielt im Jahr 1941, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Irland ist zwar neutral, aber die Toten haben da so ihre eigenen Ansichten. Schließlich liegt hier ein absoluter Hitler-Anhänger neben einem französischen Piloten, der ein wenig Irisch studiert und ansonsten munter plaudert: “Monsieur Churchill a dit qu’il retournerait pour libérer la France, la terre sacrée…”. [Anm.: “Herr Churchill hat gesagt, dass er zurückkommen wird, um Frankreich zu befreien und die heilige Erde…”].
Immer wieder wird auch der irische Bürgerkrieg neu ausgefochten. Die Frage, wer 1941 das „All-Ireland Football Championship Finale“, Kerry oder Galway, gewonnen hat, droht uralte Freundschaften zu zerlegen [Anm.: Gaelic Football, Kerry gewann]. Ich erfahre einiges über Schwindsucht und Tod im Kindbett, Magenverrenkungen, oder auch überraschendes Ableben aus dem „Nichts“, aus voller „Blüte“. Kurzum, unter der Erde ist es alles andere als mucksmäuschenstill und „die letzte Ruhe“ findet niemand. Es geht meistens um das Leben und seine Umstände an sich – und aufgrund der Behandlung des Alltäglichen als das Wichtige und Aufmerksamkeit erregende wird Máirtín Ó Cadhains größtes Werk häufig mit denen von James Joyce und (seltener) von Samuel Beckett verglichen.
Zu Beginn der zehn Kapitel, die allesamt „Zwischenspiel“ genannt werden, spricht das „Schallhorn des Friedhofs“: Es sind poetisch dichte, kurze Absätze über das Ausmaß der Lage, wenn man erst einmal unter der Erde ist. Das Schallhorn (Rufhorn), die Stimme des Friedhofs und seit undenklichen Zeiten dort, kommentiert die Geschehnisse. Eine gute Hilfe zum besseren Verständnis sind die Hinweise zur Aussprache des Irischen und den Besonderheiten der Schreibung nebst Anmerkungen und Zeittafel (Leben, Werk und Zeit Máirtín Ó Cadhain) im Anhang des Buches.
Die Kreationen der Übersetzerin: Entenmelkerin, Drecksfußsippe, Moderarsch, Einohrbrut . . .
Die Beschimpfungen und Kraftausdrücke waren für die Übersetzerin Gabriele Haefs eine Herausforderung und es entstanden aus dem irischen Geplapper ganz eigene Sprachvarianten: „Entenmelkerin“, „Drecksfußsippe“, Moderarsch“, Einohrbrut“.
Gabriele Haefs erzählt über die Schwierigkeit ihrer Arbeit, welche vom Deutschen Übersetzungsfond gefördert wurde und der irischen Ausgabe von 1949 folgte:
“Der Originaltitel lautet „Cré na Cille“, das wird meistens mit „Friedhofserde“ übersetzt, ist aber nicht ganz richtig, wörtlich wäre es „Erde der Kirche“, Friedhofserde wäre „Cré na Reilige“, aber egal, wir können den Autor nicht mehr fragen, denn Máirtín Ó Cadhain (geb. 1906) starb schon 1970. Wir können ihn so vieles nicht mehr fragen, und bei den Ungereimtheiten in seinen Buch streiten sich die Gelehrten: Wenn Caitriona einmal 72 ist, dann aber 91, ist das ein Satzfehler oder will der Dichter uns damit etwas sagen?
Wenn zwei Tote bei einem Streitgespräch die irischen mittelalterlichen Epen durcheinander werfen, was dann? Da sich die Gelehrten nicht einigen können, muß die arme Übersetzerin selbst entscheiden… und Alle erwarten tiefgründige Ausführungen über den Wortschatz des Autors, die von ihm selbst erfundenen Wörter und so. Aber ehrlich, viel schwieriger fand ich es, die Ungereimtheiten auf eine irgendwie „gereimte“ Weise zu klären. Und darüber hinaus, daß sich alle Welt einmischt und eine eigene Meinung zu der Übersetzungsarbeit hat, auch wenn diese Meinung durch nichts begründet ist. So bekam ich mehr als ein Dutzend Hinweise darauf, daß ich aber die Verwünschungen und die grobe Sprache des Autors richtig wiedergeben müßte, und die hilfreichen Herren (waren nur Herren) boten auch gleich Beratung bei der Wortsuche an. Das Problem war nur, daß keiner der Herren Irisch kann…“.
„Es gibt übrigens inzwischen zwei Übersetzungen ins Englische. Die eine („The Graveyard Clay“), von Tim Robinson und Liam Mac Con Iomaire, ist sehr werk- und wortgetreu. Die andere („The Dirty Dust“) von Alan Titley, ist das nicht“, so Gabriele Haefs. Die Übersetzerin merkt an, „dass Alan Titley selbst sagt und im Vorwort zu seiner Übersetzung schreibt, dass er sich Freiheiten herausgenommen hat und seiner Ansicht nach so übersetzt, wie Mairtín Ó Cadhain heute schreiben würde, wenn er eben heute schriebe. Aber ich weiß nicht, wie man das beurteilen will, ich würde mir das nie und nimmer zutrauen. Es kommt dabei zu solchen Dingen, wie dass bei Titley so ungefähr in jedem zweiten Satz “fuck” steht, und das glaub ich nicht. Máirtín Ó Cadhain war ein Gentleman, der seine Worte sehr gewählt und behutsam setzte. Im Original kommt einmal das irische Wort für „ficken“ vor, das ist alles“. So weit die Übersetzerin.
Mein Fazit: Ein fulminanter Roman, eine humorvolle und gleichermaßen zickige Satire. Cré na Cille würde ich als “Museum für die Irische Sprache” bezeichnen und welch ein Segen, dass es mit Grabgeflüster eine deutsche Übersetzung gibt. In den Roman eintauchen bedeutet kein einfaches Lesen, es braucht ein wenig Arbeit. Aber dieses zeitlose Werk werde ich sicher immer einmal wieder aufschlagen, um mich an den wilden und verrückten Dialogen zu erfreuen – und wer wird denn Angst vor dem Tod haben, wenn “unten” so viel los ist…
Das Buch kann hier bei unserem Partner Buch7 online bestellt werden
* Máirtín Ó Cadhain: Grabgeflüster
Aus dem Irischen von Gabriele Haefs, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2017. 461 S., Leinen-Einband, 24,90 [Euro].
Máirtín Ó Cadhain, in Irland selbst auf einer Stufe mit James Joyce, gilt als einer der wichtigsten Autoren in irischer Sprache. Er wurde 1906 (im selben Jahr wie Beckett) westlich von Galway, in einer ausschließlich irischsprachigen Gegend, geboren und starb 1970 in Dublin. Man sagt, bis zu seinem sechsten Lebensjahr habe er kein Wort Englisch gehört. Zunächst Lehrer, engagierte er sich immer stärker in der Irisch-Republikanischen Armee und verlor 1936 seine Arbeit. Von 1940 bis 1944 war Ó Cadhain im Internierungslager Curragh Camp inhaftiert; nach dem Krieg arbeitete er in Dublin als Übersetzer und Professor für Literatur im Trinity College, wo ein Lesesaal nach ihm benannt ist.
 Gabriele Haefs, eine der bekanntesten Übersetzerinnen für den skandinavischen Raum, hat Volkskunde, Sprachwissenschaft, Keltologie und Skandinavistik studiert und ist damit eine der wenigen Übersetzerinnen, die sich ans Irische wagen dürfen. Sie wurde u.a. mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis ausgezeichnet, 2008 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr übersetzerisches Gesamtwerk, 2011 erhielt sie den Königlich-Norwegischen Verdienstorden.
Gabriele Haefs, eine der bekanntesten Übersetzerinnen für den skandinavischen Raum, hat Volkskunde, Sprachwissenschaft, Keltologie und Skandinavistik studiert und ist damit eine der wenigen Übersetzerinnen, die sich ans Irische wagen dürfen. Sie wurde u.a. mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis ausgezeichnet, 2008 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr übersetzerisches Gesamtwerk, 2011 erhielt sie den Königlich-Norwegischen Verdienstorden.
Fotos:
Graveyard: Cill Éinne graveyard on Inishmore, Aran Islands, (© Copyright Roger Leege), mit freundlicher Genehmigung von Roger Leege.
Buchcover und Máirtín Ó Cadhain: Mit freundlicher Genehmigung vom Alfred Kröner Verlag.
Gabriele Haefs und ‘Das irische Original „Cré na Cille“ von 1949, Gabriele Haefs bei der Übersetzungsarbeit. Mit freundlicher Genehmigung von Gabriele Haefs.



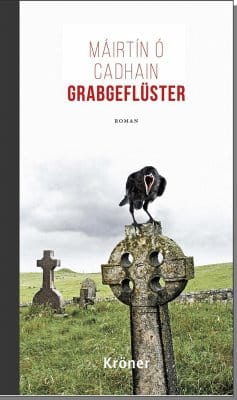
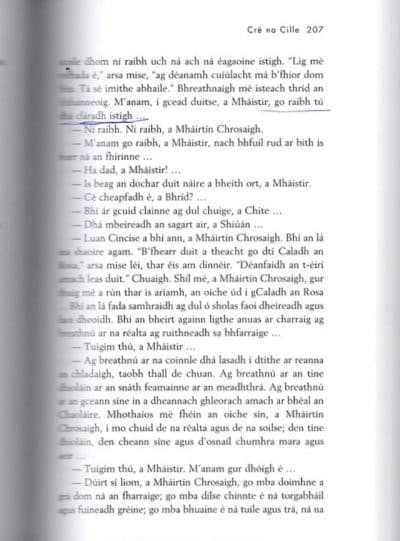






Eine tolle und sehr informative Buchvorstellung, Sandra! Kriege Lust, sie zu lesen, und sie klingt, ehrlich gesagt, noch etwas unterhaltsamer.
Vielen Dank für den Link, lieber Werner, ein sehr schönes Kurz-Portrait. Ja, Máirtín Ó Cadhain galt als unbequemer und schwieriger Mitmensch, auch auf politischer Ebene.
Es gibt eine Website, auf der man biografisches Material und Informationen über die politische Aktivität von Ó Cadhain, aber auch Berichte über seine literarischen Werke einsehen kann (mit Rezensionen von verschiedenen Experten auf dem Gebiet der irischsprachigen Literatur):
https://www.xn--mirtncadhain-cbb5oqd.ie/mairtin-o-cadhain-information-in-english/
Grüße, Sandra
Aus Anlass des Begräbnises 1970 von Máirtín Ó Cadhains wurde ein kleines Portrait von ihm gedreht. Auf youtube kann man es ansehen. Dort steht:
“Über dreißig Jahre nach seinem Tod wartet dieser höchst umstrittene Ire, Mairtín Ó Cadhain, immer noch auf seinen Biografen. Zu seiner Zeit war Ó Cadhain eine furchteinflößende und einschüchternde Figur, doch seitdem hat er einen langen Schatten geworfen. Dieses Programm zeichnet das Leben und die Zeit des Schriftstellers, Republikaners, Lehrers, Aktivisten für die gälische Sprache und Universitätsprofessors nach, von seiner Jugend in Cnocán Glas in der Connemara Gaeltacht (gälischsprachiges Gebiet) bis zu seinem Tod in Dublin im Jahr 1970.” (Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator).
https://www.youtube.com/watch?v=WP23SxvECSs
Werner
Vielen Dank, lieber Werner, man muss sich in der Tat darauf einlassen (wollen). Mich hat das Sprachgewirr in den Dialogen ein wenig an ‚Ulysses‘ von James Joyce erinnert (ich hatte mal versucht, mich durchzufinden…).
Es gibt übrigens eine Verfilmung von Cré na Cille (erschienen 2007), auf DVD erhältlich. Der Film wurde an verschiedenen Orten in Connemara gedreht, mit vielen lokalen Akteuren, in Gedenken an Ó Cadhains Hundertjahrfeier. Es wurde eine aufwändige Holzkonstruktion gebaut und verfüllt, um die „Unterwelt“ nachzustellen. Ich hatte das ‚Making-of‘ auf YouTube gesehen, es ist leider nicht mehr verfügbar. Die Produzenten wiesen darauf hin, dass der Film nicht viel später hätte produziert werden dürfen: Es wird immer schwieriger, Schauspieler zu finden, die dieses reich strukturierte, komplexe Irisch sprechen können. Es gibt einen Trailer vom Film, in dem man in die von reichem Connemara-Irish geprägten Dialoge eintauchen kann (mit engl. Untertiteln):
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XcXNTJ1tR1c&list=PLEKAxmleyVAzwMgL8P9yTr3gK53f3DkN9&index=2
Neben der Bibel steht Máirtín Ó Cadhains Cré na Cille wohl bei vielen einfachen Bewohnern
der Gaeltacht-Gebiete im Bücher-Regal. Sie heg(t)en große Sympathie für Ó Cadhain (auch als er längst in Dublin lebte). Er galt er immer als einfacher Mensch, als „einer der ihren“, der aus der Gaeltacht kam.
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg,
Sandra
Liebe Sandra,
ganz lieben Dank für die unfangreiche und detaillierte Buchbesprechung. Man merkt ihr an, wie die nicht ganz einfache Lektüre Arbeit ist aber wohl zum Gewinn von Sprachlust, Fantasie und Witz führen kann.
Die Grundidee kommt mir sehr bekannt vor:
Robert Seethaler hat sich in seinem 2018 erschienenen Roman “Das Feld” – wissentlich oder unwissentlich – ganz schön daran bedient… Seine Ausführung der Geschichten der Toten aus der fiktiven Kleinstadt Paulstadt ist aber deutlich gediegener in der Ausführung. Ist halt auch ein Österreicher und kein Ire.
Herzliche Grüße
Werner